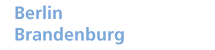
Die Cheruskerkurve (Schöneberg/Südkreuz
<> Potsdamer Pl.)
Seit
1944 stillgelegt, Wiederaufbau geplant

Am 15. Oktober 1881 wurde eine Spitzkehre eröffnet, die sich vom
Südring bis zum Potsdamer Bahnhof erstreckte. Sie war die erste
Verbindung der Ringbahn zum damaligen Stadtzentrum um den Potsdamer
Platz. Da der Potsdamer Bahnhof in dieser Zeit immer stärker belastet
wurde, errichtete man 1890/91 gleich daneben einen seperaten „Ringbahnhof“.
Zwischen der Ringbahnstrecke bei Papestraße und dem Potsdamer
Ringbahnhof bestand seit Eröffnung der Strecke ein weiterer Haltepunkt,
der Bahnhof Schöneberg (ab 1.12.1932 mit Namen „Kolonnenstraße“)
an der heutigen Julius-Leber-Brücke. Dort hielten zwischen 1882
und 1891 auch Züge der Potsdamer Stammbahn.
Das Empfangsgebäude des Bahnhofs Kolonnenstraße war aus Backstein
erbaut und mit einem Türmchen versehen. Das Bauwerk, das Meyer-Kronthaler
& Kramer (1999) sinnbildlich als „kleine Bahn-Burg“
bezeichnen, wurde jedoch im Zuge der nationalsozialistischen Stadtumgestaltung
1936 abgerissen und durch einen provisorischen Zugang ersetzt.
Die Südring-Spitzkehre verband die Wohngebiete südlich von
Berlin mit dem Zentrum und dem Regierungsviertel nahe des Potsdamer
Bahnhofes. Bahntechnisch diente sie als Pufferstrecke (neudeutsch besser
als „Cache“ zu bezeichnen) für die lange Ringbahnabschnitt:
Hier konnten Verspätungen aufgeholt werden, die sich sonst bei
den stundenlang im Kreis verkehrenden Ringbahnzügen aufsummiert
hätten. Da die Südring-Spitzkehre südlich des Bahnhofes
Kolonnenstraße parallel der Cheruskerstraße verlief, erhielt
sie bald den Namen „Cheruskerkurve“, unter den sie bis heute
in Planungsentwürfen firmiert.
Die 800 Meter lange Cheruskerkurve wurde 1929 elektrifiziert und am
18.April des Jahres für den S-Bahn-Verkehr freigegeben. Ab sofort
konnten die S-Bahnzüge aus Richtung Westkreuz hinter dem Bahnhof
Schöneberg auf die Cheruskerkurve abzweigen. Sie fuhren weiter
über den Bahnhof (Kolonnenstraße), bis sie am Potsdamer Ringbahnhof
endeten. Hier machten die Ringzüge „Kopf“ und kehrten
über den Bahnhof Kolonnenstraße und die östliche Cheruskerkurve
zurück zum Bahnhof Papestraße, um in Richtung Ostkreuz weiterzufahren.
Der Bahnhof Kolonnenstraße lag ungefähr 300 Meter südlich
des Bahnhofs Großgörschenstraße der parallel verlaufenden
Wannseebahn, die nicht an der Kolonnenstraße hielt. Die Ringbahn-Fahrgäste
mussten demnach vom nördlichen Ausgang des Bahnhofes Kolonnenstraße
über eine Fußgängerbrücke und einen zwischen den
Gleisen errichteten Pfad (wegen seiner eingezwängten Lage „Hammelgang“
genannt) zum Bahnhof Großgörschenstraße bewegen. Als
die unterirdische Nord-Süd-S-Bahn (heute S1) zwischen Großgörschenstraße
und Humboldthain kurz vor dem 2. Weltkrieg entstand, wurde der Bahnhof
Großgörschenstraße um ca. 200 Meter in seine heutige
Lage verschoben. Die Ringbahnfahrgäste konnten jetzt über
den im März 1933 eröffneten Kreuzungsbahnhof Schöneberg
(in Höhe des ehemaligen Ringbahnhofs an der Ebersstraße gelegen)
bequemer in die Wannseebahn umsteigen.
Nachdem am 3. Juli des Kriegsjahres 1944 die Cheruskerkurve und der
Potsdamer Ringbahnhof so stark bei Luftangriffen beschädigt wurden,
dass sie nicht mehr befahrbar waren, konzentrierten sich die S-Bahnen
der Zuggruppe A erstmals nur auf den sogenannten 37 Kilometer langen
„Vollring“. In der Nachkriegszeit wurde die Cheruskerkurve
nicht wieder aufgebaut, da sie schon vor ihrer Stilllegung nur noch
ein geringes Fahrgastaufkommen aufwies. Als der Bahnhof Schöneberg
eröffnet wurde, der ein bequemes Umsteigen zwischen Ring- und Wannseebahn
ermöglichte, hatte die Strecke schlagartig an Bedeutung verloren.
Die
brachliegende Trasse wurde in den 1960er Jahren zum Planungsraum für
die „autogerechte Stadt“. Die sog. „Westtangentenautobahn“
sollte sich, von Steglitz kommend, auf der alten Bahntrasse neben der
Wannseebahn quer durch die ganze Stadt bis zum Wedding erstrecken. Pläne
aus den 1980er Jahren sahen sogar eine unterirdische S-Bahnlinie 1 vor,
deren Züge unter der „Schöneberger Insel“ hindurch
den Bahnhof Yorckstraße (S2) anfahren sollten. Widersinnigerweise
sollte dies geschehen, damit die lärmintensive Autobahn oberirdisch
auf der Trasse der S1 bis Tiergarten verlaufen konnte. Die Anwohner
der benachbarten Cheruskerstraße gründeten daraufhin die
bekannte „Bürgerinitiative Westtangente“, die sich
bis heute für Umweltbelange engagiert. Die Westtangente wurde dank
der wirkungsvollen Publicity der Bürgerinitiative von Steglitz
nur bis zum Sachsendamm gebaut und endet wenige Meter vor Beginn der
stillgelegten Cheruskerkurve. Aus ihr entstand eine zunehmend verwahrlosende
Grünfläche, die paradoxerweise als „Cheruskerpark“
bezeichnet wird.
Nach den Planfeststellungen zum Bau des neuen Eisenbahn¬knotenpunkts
am Lehrter Bahnhof wird die Cheruskerkurve seit den 1990er Jahren wieder
für die S-Bahn freigehalten. Erste Vorstellungen gingen von einer
Wiederinbetriebnahme auf der alten ebenerdigen Trasse aus, doch aus
‚Furcht’ vor den protesterprobten Anwohnern des Cheruskerparks
wurde 2002 die Trassenführung im Tunnel als Änderung im Flächennutzungsplan
durchgesetzt. S-Bahn-Linie 21 heißt dieses Projekt. Die Strecke
soll vom neuen Südkreuz über die Cheruskerkurve, mit Halt an der Julius-Leber-Brücke, der neuzubauenden
Station Gleisdreieck, dem Hauptbahnhof,
den Nordring und die Siemensbahn bis zur Wasserstadt Spandau verlaufen.
An der Cheruskerkurve könnte man vielleicht exemplarisch einen
erfreulichen Wandel in der Berliner Verkehrsplanung der letzten 40 Jahren
ablesen, der dahin geht, wieder mehr S-Bahn-Neubauten statt Stadtautobahnen
vorzusehen.
Verwendete Literatur
Braun, M. (2000): Was macht eigentlich die S 21 ? In: Berliner Verkehrsblätter, 8, 2000, S.145 – 150.
Dittfurth, U. et al. (1993): Strecke ohne Ende. Die Berliner Ringbahn. Berlin: GVE Verlag.
Meyer-Kronthaler, J. & Kramer, W. (1999): Berlins S-Bahnhöfe. Ein dreiviertel Jahrhundert. Berlin: be.bra Verlag.
Müller, F. (2004): Berliner S-Bahn-Strecken außer Betrieb. Cheruskerkurve (Südringkurve – Kolonnenstraße). http://www.stillgelegte-s-bahn.de/cherusker/cherusker.htm
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (2000): Teilbereich Cheruskerkurve, Lfd. Nr. 37/95, Änderung im Flächennutzungsplan.
Strowitzki, B. (2002): S-Bahn Berlin. Geschichte(n) für unterwegs. Berlin: GVE Verlag.